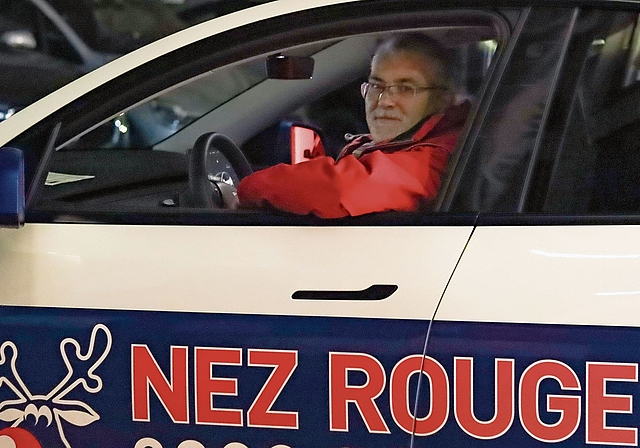Wohltat mit Haken: Wohin Kleiderspenden wirklich gehen
Fast Fashion Die Schweiz sammelt jedes Jahr Zehntausende Tonnen Altkleider – unter dem Eindruck, damit Gutes zu tun. Doch ein grosser Teil der Spenden landet auf internationalen Märkten – oder im Müll.

In den Sammelcontainern türmen sich T-Shirts, Jacken, Jeans und Blusen – viele davon kaum getragen. Rund 110000 Tonnen Textilien fallen jährlich in der Schweiz an, etwa 65000 Tonnen werden über Organisationen wie Texaid, Tell-Tex oder Caritas gesammelt. Doch nicht alles, was gespendet wird, hilft wirklich.
Die Idee der Kleiderspende klingt simpel: Man trennt sich von Überflüssigem und jemand anderes profitiert davon. Doch der Weg vom Container zum Kleiderschrank einer bedürftigen Person ist oft ein Umweg durch ein System, das von komplexen wirtschaftlichen Interessen geprägt ist.
Überflutet von Fast Fashion
«Die Qualität der Kleidung hat sich in den letzten 18 Monaten deutlich verschlechtert», sagt Sascha Sardella, Betriebsleiter von Tell-Tex. Besonders Kleidung von Ultra-Fast-Fashion-Marken wie Shein sei oft unbrauchbar – zu billig produziert, aus synthetischen Mischgeweben, weder wiederverwendbar noch recycelbar. Ein grosser Teil davon landet am Ende in der Kehrichtverbrennung.
Auch wirtschaftlich wird die Lage immer angespannter. Der Gebrauchtkleidermarkt ist übersättigt, die Nachfrage nach Secondhandware sinkt. «Jedes hundertste Kleidungsstück findet noch eine Abnehmerin», so Sardella. Gleichzeitig unterbieten Neuwaren aus Asien selbst die günstigsten Secondhandpreise – was die Wiederverwertung erschwert.
Vom Spenden zum Geschäftsmodell
Vor allem Texaid und Tell-Tex vermarkten den Grossteil der gesammelten Kleidung kommerziell: Rund 58 Prozent bei Texaid und 65 Prozent bei Tell-Tex werden zu Secondhandware weiterverkauft – vorwiegend ins Ausland. In grossen Ballen gebündelt landen sie in Sortierzentren in Osteuropa, Italien oder Belgien. Von dort aus gehen sie weiter auf Märkte in Afrika, Asien oder Osteuropa.
Texaid weist allerdings darauf hin, dass es sich bei der Textilsammlung nicht um klassische Spenden handle: «Grundsätzlich erhält Texaid keine Spenden. Gebrauchte Textilien gelten in der Schweiz als Siedlungsabfall. Wir erfassen, sortieren und recyceln diese im Auftrag der Gemeinden», teilt das Unternehmen mit. «Wir sind überzeugt, dass sich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit nicht ausschliessen, sondern dass nur im Zusammenspiel langfristiger Erfolg möglich ist.»
Auch Sascha Sardella von Tell-Tex betont: «Kleider sind keine Spenden, sondern gehören zum Siedlungsabfall – wie Glas oder Papier. Die Sammlung, die Löhne, Betriebskosten sowie die Abgaben an Gemeinden und Städte müssen über den Verkauf der Kleidung finanziert werden. Wir sind ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen.» In der Schweiz selbst betreibt Texaid bisher nur vereinzelt eigene Secondhandläden, Tell-Tex verzichtet ganz auf eigene Shops. Eine kostenlose Abgabe an Bedürftige gibt es bei beiden nicht.
Ein anderer Weg: Caritas
Caritas Schweiz verfolgt einen deutlich anderen Ansatz. Die gespendeten Kleider werden lokal sortiert und in eigenen Secondhandläden günstig angeboten – insbesondere für Menschen mit kleinem Budget. Wer im Besitz einer Kulturlegi ist, bekommt zusätzliche Rabatte. Auch kostenlose Abgaben im Rahmen der Nothilfe sind möglich.
Was sich nicht verkaufen lässt, wird weitergegeben – an Partner für Katastrophenhilfe oder zur industriellen Verwertung. Nur was gar nicht mehr brauchbar ist, landet in der Entsorgung. «Der Altkleidermarkt ist umkämpft. Was uns betrifft, so haben wir verhältnismässig hohe Kosten, weil wir sämtliche Kleider in der Schweiz und von Hand sortieren», erklärt Daria Jenni von Caritas Schweiz. «Gleichzeitig sind wir von unserem Konzept überzeugt: Die lokale Sammlung, Sortierung und Wiederverwendung ist nachhaltiger, als wenn alle Prozesse ins Ausland verlagert und die Kleider exportiert werden. Zudem schaffen wir Jobs und Plätze in Arbeitsintegrationsprogrammen.»
Rund 70 Prozent der gespendeten Kleidung können laut Caritas wiederverwertet werden. Etwa ein Viertel wird in Partnerländer der Caritas exportiert. Der Rest geht an Kunstschaffende oder wird fachgerecht entsorgt.
Auch die zunehmende Fast Fashion bereitet Probleme: «Früher bestanden die Kleidungsstücke noch aus 100 Prozent Baumwolle, heute verwenden die Produzenten häufig synthetische oder minderwertige Stoffe wie Elastan und Polyester», so Jenni. «Sie sind weniger strapazierfähig und schneller kaputt. Das ist ein Problem für uns, da wir weniger an armutsbetroffene Personen weitergeben können und mehr entsorgen müssen.» Zugleich macht Jenni deutlich, dass man die Verantwortung nicht primär bei den Konsumenten, sondern bei den Herstellern und Verkäufern sieht.
Kritik an der Intransparenz
Tell-Tex betont, dass das Unternehmen freiwillig Beträge an Hilfsorganisationen ausschüttet. «Mehr erfahren Sie über die Nachhaltigkeitsberichte auf unserer Homepage», heisst es. Konkrete Beträge werden jedoch nicht genannt.
Texaid nennt für das Jahr 2023 eine Ausschüttung von über zwei Millionen Franken an karitative Partner wie Caritas, das Rote Kreuz und weitere Organisationen. «Der Erlös aus dem Verkauf deckt in erster Linie die Kosten für Sammlung, Sortierung und Verwertung der Alttextilien», so Texaid. «Zusätzlich erhalten die meisten Gemeinden Konzessionsgebühren, die für die Finanzierung des Siedlungsabfalls eingesetzt werden müssen.»
Beide Firmen verweisen auf die stark rückläufige Qualität der Sammelware und sinkende Erlöse als Herausforderungen – eine Folge des massenhaften Konsums von Ultra-Fast-Fashion.
Ein Exportproblem mit Folgen
Ein bedeutender Teil der exportierten Kleidung landet in Ländern wie Ghana oder Kenia – dort, wo Textilabfall aus Europa oft die Umwelt verschmutzt. In Accra, der Hauptstadt Ghanas, türmt sich der importierte Altkleiderberg inzwischen über 20 Meter hoch. Und auch auf der Dandora-Deponie in Nairobi (Kenia) landet täglich Ware, die hierzulande als Spende gedacht war.
«Das Publikum wirft seine Kleidung mit guten Absichten in die Container. Leider landet ein Grossteil davon auf Müllbergen im Süden», kritisiert Greenpeace Schweiz. «In Wirklichkeit lagern die Länder des Nordens ihre Probleme mit dem Überkonsum im Zusammenhang mit Fast Fashion aus – in Länder, die nicht über die nötige Infrastruktur verfügen.»
Die Kritik richtet sich weniger gegen die Sammelstellen als gegen das globale System: «Das Problem liegt nicht in erster Linie in der Kleidersammlung, sondern in der Überproduktion der Modeindustrie», heisst es bei Greenpeace. «Die Schweiz exportiert jährlich rund 60000 Tonnen Textilien – offiziell meist in europäische Länder. Doch diese sind oft nur Zwischenstation.»
Besonders problematisch sei, dass es in der Schweiz keine gesetzliche Kontrolle über den Zustand der exportierten Kleidung gebe: «Niemand weiss genau, was in welcher Menge exportiert wird. Es wäre nötig, dass alle Textilsammelorganisationen in der Schweiz sortieren müssen – damit nur tragbare Kleidung ausgeführt wird. Die ökologischen Folgen sind massiv: Unser übermässiger Kleiderkonsum führt zu einer weitreichenden Verschmutzung von Flüssen, Böden und Luft – Tausende von Kilometern entfernt», so Greenpeace. «In Ghana kommen jede Woche 15 Millionen gebrauchte Kleidungsstücke an. Ein Grossteil davon ist von so schlechter Qualität, dass sie keinen Wiederverkaufswert haben – und auf offenen Deponien landen.»
Zwischen Ideal und Realität
Was als gute Tat beginnt, endet nicht selten in einem globalen Kreislauf von Überproduktion, Export und Entsorgung. Wer Kleider spendet, sollte wissen: Nicht jedes Stück hilft – und nicht jeder Container gehört zu einer karitativen Organisation.
Greenpeace sieht Handlungsbedarf auf mehreren Ebenen – auch politisch: «Der Bundesrat muss Anforderungen an die Qualität, Langlebigkeit und Reparierbarkeit von Textilien stellen», fordert die Organisation. «Marken, die Kleidung in Umlauf bringen, sollen auch für deren Entsorgung verantwortlich sein – wie das heute bei Elektronikgeräten teils schon gilt.»
Und auf Konsumseite gelte: Kleidung länger tragen, weniger neu kaufen, Secondhand und Reparatur fördern. Laut Greenpeace könnten allein durch eine Verlängerung der Tragezeit um drei Jahre jährlich rund 1,5 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden – so viel wie der gesamte Ausstoss von 100000 Menschen.
Die Schweizer Sammellandschaft steht vor einem Wendepunkt: Zwischen wirtschaftlichem Druck, Umweltproblemen und wachsender Kritik braucht es neue Ideen für einen ehrlichen und nachhaltigen Umgang mit Textilien. Klar ist: Bewusster Konsum beginnt nicht erst beim Kauf – sondern beim Loslassen.