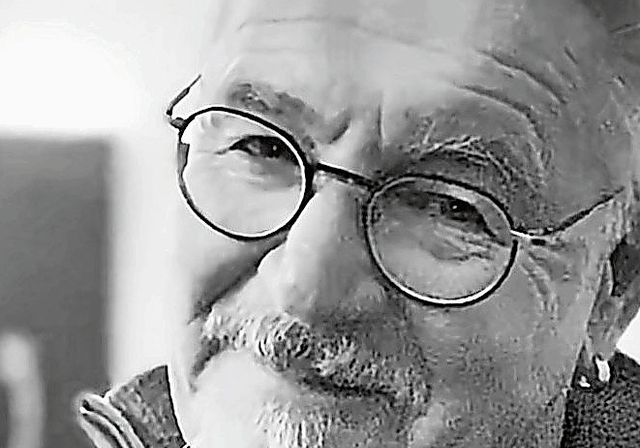Raritäten und Spezialitäten vereint
Möriken-Wildegg Museum Aargau und Slow Food Schweiz arbeiten künftig für den Tulpenzwiebelmarkt auf Schloss Wildegg zusammen und verfeinern die kulinarische Komponente des Markts.
Der Tulpenzwiebelmarkt auf Schloss Wildegg ist national bekannt für seine seltenen, alten und besonderen Sorten. Auch dieses Jahr stehen am traditionellen Markt wieder rund 25000 Tulpenzwiebeln zum Verkauf. Neu wurde der Markt kulinarisch aufgewertet. Der kulinarische Teil am Tulpenzwiebelmarkt ist zwar nicht neu. Schon zuvor wurde mit regionalen Produkten ein Publikum angesprochen, das gerne geniesst; neu müssen Produkte, die am Markt angeboten werden, der Philosophie von Slow Food Schweiz entsprechen. Das heisst, die Produkte dürfen nur natürliche Zutaten enthalten, keine Farbstoffe, Geschmacksverstärker oder chemische Konservierungsstoffe enthalten und müssen mit umweltschonenden Verfahren hergestellt werden.
Handgemachte Köstlichkeiten
Zu entdecken gibt es an den Slow-Food-Ständen Köstlichkeiten aus der Region wie frischgepressten Most aus dem Seetal, Wein und Essig aus Staufen oder Trockenwürste aus Wildegg, aber auch Raritäten von weiter her wie Alpensalz, Mürbel (Caramel) aus dem Thurgau oder Wollschweinprodukte aus Birmensdorf stehen zum Verkauf.
«Um der zunehmenden nationalen Ausstrahlung des Tulpenzwiebelmarkts gerecht zu werden, wollten wir einen Genussmarkt dazugeben, der sich qualitativ auf hohem Niveau abhebt und den Tulpenzwiebelmarkt passend ergänzt», begründet Direktor Museum Aargau und Präsident der Schweizer Schlösser Marco Castellaneta das neue Konzept. Mit der Slow-Food-Kulinarik soll der Markt laut dem Schlösserpräsidenten auch seiner Absender-Adresse alle Ehre machen. «Schliesslich ist die Wildegg das einzige Bioschloss der Schweiz.» Die Besucher können am Markt aber nicht nur mit den Produzenten auf Tuchfühlung gehen, im Slow-Mobile können sie Slow Food mit allen Sinnen entdecken oder selbst Hand anlegen beim Früchte- und Gemüseeinkochen. Für ein ganz besonderes Highlight sorgt Trüffelexperte Pius Bodenmann. Besucher dürfen mit dem Experten und seinem Hund auf Trüffelsuche im Schlosswald gehen. Dort erfährt man unter anderem, warum Trüffelsuchen auch Bäumekennen heisst.
Infos unter www.schlosswildegg.ch.
«Einkauf ist Demokratie – mit jedem Kauf stimmen wir auch ab»
Interview Slow Food bedeutet auf Deutsch «Langsames Essen». Emanuel Lobeck von Slow Food Schweiz erklärt, was es mit dem Namen auf sich hat und wie man mit dem eigenen Einkauf zu einer besseren Welt beitragen kann.
Was ist Slow Food?
Emanuel Lobeck, Qualitätsprüfer Märkte, Slow Food Schweiz: Slow Food tritt für die biologische Vielfalt ein und fördert eine nachhaltige, umweltfreundliche Lebensmittelproduktion. Es ist eine Bewegung von Leuten, die das Lebensmittelsystem verändern wollen und sich aktiv daran beteiligen. Slow Food arbeitet daran, dass für alle Menschen schmackhafte, gesundheitlich einwandfrei und fair produzierte Lebensmittel zur Verfügung stehen.
Wie wollt ihr das erreichen?
Indem wir das Bewusstsein für saubere und faire Lebensmittel fördern und mit konkreten Projekten erlebbar machen. Am Tulpenzwiebelmarkt auf Schloss Wildegg zum Beispiel führt ein Sinnesparcours im Slow-Mobil vor Augen, wie sich Massenprodukte und handwerkliche Produkte geschmacklich unterscheiden. Das Slow-Mobil ist ein Projekt, mit welchem wir schon bei den Kindern ansetzen und das Bewusstsein für Regionalität und Qualität fördern – zum Beispiel können Schulen das Slow-Mobil für Koch-Ateliers buchen.
Warum braucht es den Verein Slow Food?
Slow Food möchte die Greenpeace für Lebensmittel werden, den Leuten bewusst machen, was ihr Einkauf für Konsequenzen haben kann. Denn wenn wir nur auf den Preis achtend einkaufen, kann das schwerwiegende Folgen haben. Beispielsweise, dass die Schweizer Milchbauern nicht mehr kostendeckend produzieren können, oder wir entscheiden damit, woher die Futtermittel für den Schweizer Rindfleischkonsum kommen. Ein Einkauf kann aber auch positive Konsequenzen haben. Lebensmittel, die man beispielsweise direkt beim Bauern kauft, schmecken besser. Auch wegen des persönlichen Bezugs. Einkaufen ist sozusagen Demokratie: Mit jedem Kauf stimmen wir ab und entscheiden, wie und was schlussendlich produziert wird.
Inwiefern unterstützt Slow Food Produzenten?
Wir bieten eine Plattform für ein lokales, nationales und internationales Netzwerk zwischen Produzenten und Konsumenten. Wir bringen Erzeuger von Qualitätslebensmitteln auf Veranstaltungen mit Konsumenten zusammen. Auch an den Slow-Food-Ständen am Tulpenzwiebelmarkt werden die Produzenten persönlich vor Ort sein. Eine ehrliche Beziehung zwischen Konsument und Produzent herzustellen, ist uns ein grosses Anliegen. Auch unterstützen wir beispielsweise mit den «Presidi» vom Verschwinden bedrohte, hochwertige Lebensmittel-Produktionen und fördern die kulinarische Nutzung von autochthonen Tierrassen und Pflanzenarten.
Slow Food hilft diesen Produzenten, die Qualität zu sichern, und eröffnet ihnen einen neuen Markt. Wir unterstützen auch innovative Lebensmittel-Projekte. Wichtig ist, dass die Lebensmittel pur und ehrlich hergestellt werden mit rein natürlichen Zutaten ohne zusätzliche Aromen oder chemische Konservierungsstoffe.
Slow Food gibt es seit 1986. Habt ihr einen Nachfrageanstieg in den letzten Jahren erfahren und wie habt ihr das gemerkt?
Die Anfänge der Slow-Food-Bewegung waren sozialpolitisch motiviert, Slow Food war die Gegenthese zum aufkommenden Fast Food in den 80er-Jahren. Die These passt nach wie vor zu dem, für was wir heute kämpfen.
Seither sind die Mitgliederzahlen klar gestiegen. Viel wichtiger ist uns aber, das Bewusstsein in der Bevölkerung in Sachen Lebensmittel zu steigern. Seit 1986 ist diese Wahrnehmung, aber auch das Interesse an Lebensmitteln allgemein ganz klar gestiegen. Ich bin überzeugt, dass Slow Food dazu beigetragen hat.
Was können Besucher an den neuen Slow-Food-Ständen am Tulpenzwiebelmarkt erwarten?
Es gibt ein Stück Heimat neu zu entdecken. In wunderbarem Schlossambiente kann man so viele Geschichten erleben, so viel schmökern und anfassen wie selten auf so kleinem Raum. Der Markt ist ein kleines Paradies für Leute, die neugierig sind und die Hintergründe von guten Lebensmitteln erfahren möchten. (ms)
Weitere Informationen zu Slow Food findet man unter www.slowfood.ch.